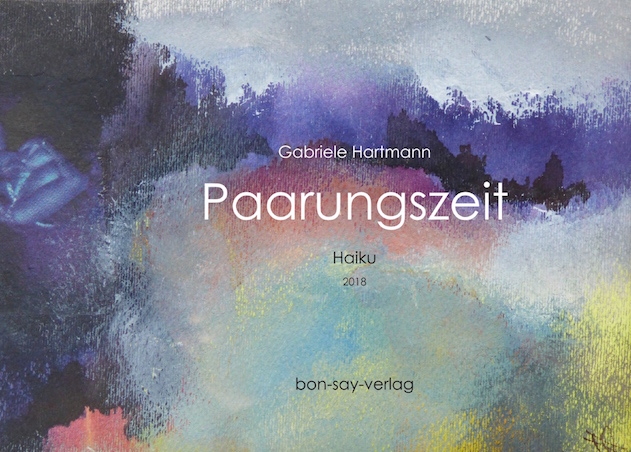„Paarungszeit“, Gabriele Hartmann
Haiku aus 2018
Ringbindung, A6 quer, 148 Seiten, 2019, ISBN 978-3-945890-31-08
Rezensionszitat Horst-Oliver Buchholz:
Sturmmond
wir streichen das Laken
glatt
Auf engem Raum nimmt das Haiku eine scharfe Wendung, baut so Spannung auf und führt ins Kontrastierende:
Sturmmond, ein äußeres raues Naturereignis größerer Art gewendet ins Kleine, Private, fast Intime … das Glattstreichen eines Lakens. Wird das Laken glattgestrichen rein der Ordnung halber? Oder nach einer Liebesnacht? Vieles ist möglich, beliebig ist es nicht. So hat dieses Haiku vieles, das ein gutes Haiku ausmacht: eine überraschende Wendung, einen spannungsreichen Gegensatz, und es lässt auch in seiner Kürze Raum für den Leser. Ein gutes Haiku eben.
Eine Rezension von Rüdiger Jung:
Immer wieder beglückend, eine neue Jahreslese der Haiku Gabriele Hartmanns in Händen zu halten. Sie beherrscht ihr Handwerk. Das fängt an bei den Jahreszeiten:
Winterlinge
noch angekettet die Stühle
im Straßencafé
Ein Gedicht über uns. Wir nennen sie „Winterlinge” – die, die blühend den Aufbruch wagen, während „im Straßencafé” „die Stühle” „noch angekettet” sind. Auch die Zeitgeschichte findet bei Gabriele Hartmann zwanglos ins Haiku – schlicht und einfach und gerade deshalb so nachhaltig:
Auffanglager
sie faltet
Kraniche
Die Autorin liefert keine Patentrezepte noch gibt sie vor, als Dichterin über jede Antwort zu verfügen:
was für Fragen!
mein Bonbon wechselt
die Backentasche
Eine kompromittierende? Dafür scheint mir die Antwort zu cool. Nein, ich denke eher an die ebenso verblüffende wie löchernde Frage eines Kindes. Wie dem auch sei: Bei harten Nüssen hilft der Wechsel der Perspektive. Da kann das Bonbon ein Anfang sein. Ambivalenz auch im folgenden Haiku:
rollender Donner
die Muschelsucherin hält den Blick
gesenkt
Angst vor dem Gewitter? Oder eher der zielgerichtete Blick, der sich nicht beirren lässt ? Der schmale Raum des Haiku reicht Gabriele Hartmann für ausdrucksstarke Liebesgedichte, die Bände sprechen:
drei Wünsche
dass sie nicht enden
deine Küsse
Bei der Fee im Märchen hat man drei Wünsche frei. wir kennen die Klippe: sich Belangloses zu wünschen, auf das Wichtigste gar nicht zu kommen. Wenn hingegen gleich der erste Wunsch „sitzt”, braucht es nur noch das zweifache Betätigen der Repeat-Taste.
alte Eiche
gewachsen noch
das Herz
Inmitten einer Welt, die eher schrumpfende Herzen wahrnimmt, ein Wachsen, das nicht kühn behauptet, sondern vertrauensvoll konstatiert wird. Haben Sie, liebe Leserin / lieber Leser, je an die Vereinbarkeit von „Abwarten und Teetrinken” einerseits und „knisternder Erotik” andererseits geglaubt? Längst nicht so abwegig, wie es zunächst klingt:
knisternder Kandis
wir lassen unser Gespräch
noch etwas ziehen
Als Pfarrer stoße ich immer wieder auf die zahlreichen religiösen Konnotationen im Werk der Autorin:
auch ich bin
einer der Menschen
hinter dem Zaun
Ein Text, der für mich zutiefst geeignet ist, eine Passionsandacht zu bereichern. Verkürzt kennt die Passion drei Gruppen von Menschen: die, denen Leid zugefügt wird; die, die Leid zufügen; schließlich die Zuschauer. Natürlich ist das idealtypisch gedacht: Jeder von uns hat Anteil an allen drei Gruppen. Das Haiku hat etwas von einem Bekenntnis. Da gibt ein Mensch zu, als Zuschauer zu verharren, wo seine Stimme, sein Engagement gefragt gewesen wäre. Nicht weniger präzise die weihnachtlichen Texte:
Krippenspiel
der Esel hat den Text
vergessen
Haiku haben keinen Titel, sonst könnte hier naheliegen: „Idealbesetzung”. Aber Vorsicht – so eindeutig müssen die Dinge nicht sein. Hat der Esel vielleicht nur vergessen IAH zu sagen – und ist kein grauer Ja-Sager mehr ? Weihnacht ist Trubel – und Trubel nicht das Eigentliche. Weshalb sich die Weihnacht vielleicht die letztmögliche Insel sucht:
vor dem Fest
noch einmal
die Stille
Religiös konnotiert begegnet zweimal auch die Grenze aller kurzen Gedichte: das Schweigen:
Schneewolken
der Eremit vertieft
sein Schweigen
Dem mystischen Erleben ist die Alltagssprache inkommensurabel. Weshalb die mystische Sprache das Paradoxon wählt. Und plötzlich zu steigern, zu „vertiefen” vermag, was sich nicht steigern lässt – das Schweigen. Trappisten stehen dafür, dass der Verzicht auf allzu oft schädliche Worte segensreich ist. Dagegen ein erneutes Paradox:
Fastenzeit
er bricht
sein Schweigen
Einer, der zu oft und an den falschen Stellen geschwiegen hat, muss gerade dieses Schweigen brechen. Dann kann nahrhaftes Wortbrot daraus werden.
Rüdiger Jung